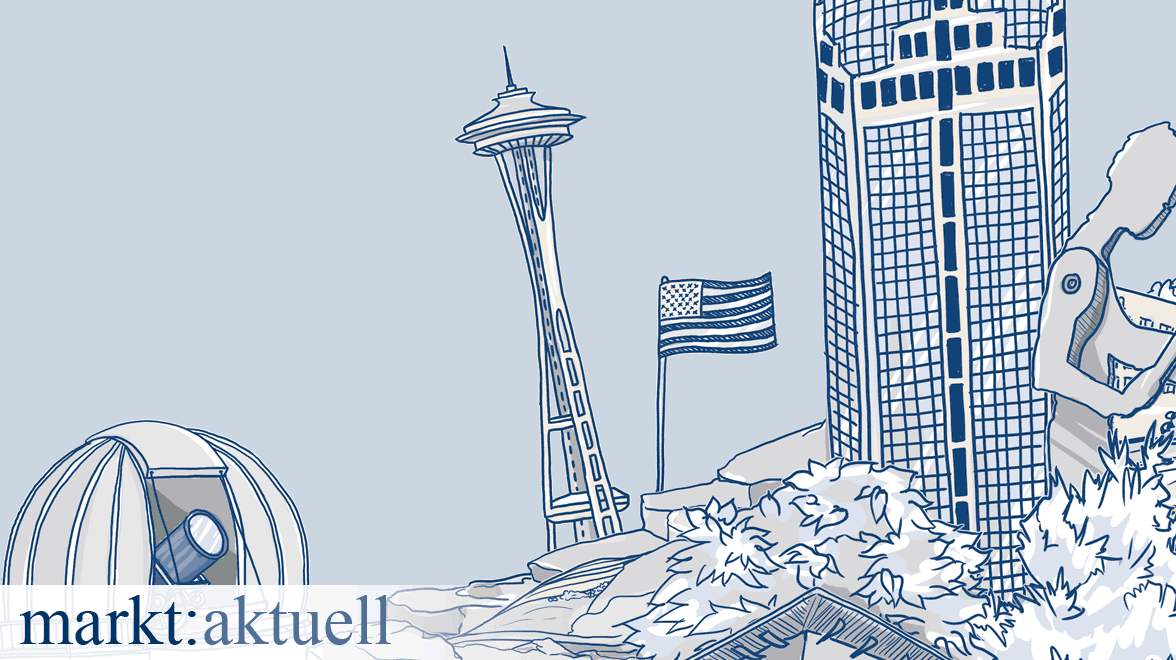Warum eine Bitcoin-Reserve Unsinn ist – und ein Stablecoin-Euro besser als der digitale Euro
Währungsreserven - eine Frage der Souveränität
Industrieländer wie die USA oder Europa benötigen traditionell keine nennenswerten Devisenreserven. Ihre Währungen sind konvertibel, global akzeptiert und mit hohem Vertrauen ausgestattet. Importiert wird in der eigenen Währung, exportiert ebenso. Kurz: Wer den US-Dollar oder den Euro druckt, braucht sich um Währungsschwankungen wenig zu sorgen.
Anders sieht es in vielen Schwellenländern aus. Dort dienen Devisenreserven – meist in USD oder EUR – als Stabilisator gegen Kapitalflucht, spekulative Attacken und externe Schocks. In diesem Kontext ließe sich argumentieren, dass eine Bitcoin-Reserve als Risikodiversifikation fungieren könnte. Aufgrund der hohen Volatilität von Bitcoin sollte die Quote an den gesamten Devisenreserven jedoch nur klein sein.
Bitcoin ist kein stabiler Anker. Die Kryptowährung schwankt stärker als jede etablierte Währung, stärker sogar als viele Rohstoffe. Das zeigt sich gerade in Krisenmomenten: Als Zufluchtsort für Anleger hat sich Bitcoin bislang nicht bewährt. Vielmehr neigt er dazu, oft bei geopolitischer Unsicherheit oder makroökonomischen Schocks gemeinsam mit (Technologie-)Aktien in die Tiefe zu stürzen. Eine Flucht in Bitcoin bei einer hypothetischen US-Schuldenkrise? Möglich. Aber ebenso wahrscheinlich ist ein Kursrutsch, wenn sich Unsicherheit in Panik verwandelt.
Bitcoin als strategische Reserve in den USA
Die Idee wirkt auf den ersten Blick disruptiv, modern, fast zwingend für eine Zeit, in der digitale Technologien als Allheilmittel für strukturelle Probleme angepriesen werden: Warum sollte ein Staat – zum Beispiel die USA – nicht auch Bitcoin als eine strategische Reserve halten? Die Kryptowährung, ursprünglich gedacht als dezentrales Gegengewicht zur staatlich gelenkten Geldordnung, wird zunehmend salonfähig, findet Eingang in Portfolios institutioneller Investoren. Doch wäre sie auch ein adäquates Instrument zur Stabilisierung der eigenen Währung?
Die Antwort darauf ist ein klares Nein: Nur solide Staatsfinanzen und eine unabhängige Zentralbank sind der Garant einer stabilen Währung – da sie heute und in Zukunft Preisstabilität gewährleisten. Vor diesem Hintergrund wirkt die Vorstellung, eine Supermacht wie die USA könnte Bitcoin strategisch als Reserve aufbauen, eher wie ein Signal der Verzweiflung denn der Stärke. Es wäre ein Eingeständnis mangelnden Vertrauens in die eigene Geld- und Fiskalpolitik.
Gold, Öl - und warum beides keine Alternativen sind
Gold wird heute nicht mehr als monetärer Anker verwendet – und das aus gutem Grund. Die Goldförderung wächst kaum noch (Peak Gold ist erreicht oder nah), während die Weltwirtschaft jährlich um ca. 2 bis 3 Prozent expandiert. Das bedeutet: Gold ist strukturell deflationär.
Öl hingegen ist ein Gebrauchsgut. Es war nie eine monetäre Referenz, sondern Handelsmedium – konkret: Es wurde in Dollar fakturiert, und die Erlöse in US-Staatsanleihen geparkt. Eine Währungsanbindung an Öl würde bedeuten, dass Öl gehortet statt verbraucht würde – mit verheerenden Folgen für Energiemärkte und Inflation.
Währungsanker - gestern Gold heute Bitcoin
Historisch war der US-Dollar lange an Gold gebunden. Wäre eine Modernisierung des alten Systems auf Basis einer Anbindung an Bitcoin denkbar?
Bitcoin wäre in dieser Hinsicht noch rigider: Mit einer fixen Obergrenze von 21 Millionen Einheiten wäre jede Anbindung an reale Wirtschaftsprozesse nicht nur illusionär, sondern geradezu kontraproduktiv. Die Deflation wäre kein Nebeneffekt, sondern ein inhärentes Merkmal – mit allen bekannten wirtschaftlichen Nebenwirkungen: Investitionszurückhaltung, sinkende Löhne, wachsender Schuldenrealwert.
Hinzu kommt ein praktisches Problem: Eine ernsthafte Anbindung des US-Dollars an Bitcoin würde einen Bitcoinpreis von mehreren Millionen Dollar erfordern, um die nötige Geldmenge zu decken. Das ist nicht nur ökonomisch unsinnig, sondern würde Bitcoin endgültig zu einem spekulativen Super-Asset machen – mit allen Risiken für Stabilität und Verteilungsgerechtigkeit.
Fazit: Bitcoin ist ein Finanz-Asset, kein Stabilitätsanker
Privatpersonen dürfen spekulieren, Staaten sollten Stabilität verkörpern. Bitcoin mag als digitales Gold gelten, doch als Einsatz als eine staatliche Reservewährung fehlt eine gute Begründung: Sollen Staaten wirklich schuldenfinanziert Bitcoin kaufen und somit auf steigende Kurse spekulieren? Sollten Schwellenländer Bitcoin als Reserve halten bei der immensen Volatilität? Taugt ein Finanz-Asset zur Reservewährung, wenn es in Krisenzeiten stark im Kurs fällt?
Und was ist mit Stablecoins?
Stablecoins sind Kryptowährungen, deren Preis durch einen automatischen Preisbindungsmechanismus mit dem Ziel geringer Abweichungen in Bezug auf eine nationale Währung gesteuert wird. Für jeden ausgegebenen Stablecoin wird der entsprechende Betrag in der Regel in kurzlaufende Staatsanleihen investiert. Stablecoins sind also Staatsanleihen-gedeckt und sind somit eine Brücke zwischen der traditionellen Finanzwelt und der Online-Welt. Stablecoins ermöglichen schnelle und kostengünstige Online-Transaktionen, insbesondere im internationalen Zahlungsverkehr.
Bisher gibt es schon Tether (USDT) mit einer Marktkapitalisierung von etwa 150 Mrd. USD und USD Coin (USDC) mit einer Marktkapitalisierung von etwa 60 Mrd. USD, die aber von kleineren Akteuren emittiert werden. Sollten die US-Regierung, Notenbank und Geschäftsbanken zusammen einen Stablecoin herausgeben, würde er weltweit wie echte US-Dollar und somit als digitales Bargeld akzeptiert werden. Die Nachfrage könnte immens sein – vor allem aus Schwellenländern mit instabilen Währungen. Die USA hätten davon zwei Vorteile: die Rolle des US-Dollars als Weltreservewährung würde erheblich gestärkt werden und es würde sehr viel Geld in US-Staatsanleihen fließen, sodass die hohen Defizite und Staatsschulden problemlos finanziert werden könnten.
Interessanterweise wäre für die Eurozone die Herausgabe von Stablecoins noch bedenkenswerter. Damit könnten die mit der Einführung eines digitalen Zentralbank-Euros verbundenen Ziele viel schneller und einfacher erreicht werden. Es könnte eine digitale Infrastruktur unabhängig von ausländischen Anbietern aufgebaut werden. Der private Sektor würde die Investitionen tätigen und das System steuern. Und es müsste nicht die umfassende und langwierige Infrastruktur für einen digitalen Euro aufgebaut werden.
Konjunkturperspektiven weltweit
Zurück zur Wirtschaft: Die Auswirkungen der US-Zollpolitik und der Turbulenzen an den Finanzmärkten in den vergangenen Wochen auf die Weltwirtschaft sind immer noch schwer abschätzbar. Dementsprechend wird sich der Fokus auf die erste Schätzung der Einkaufsmanagerindizes am Donnerstag in den USA, Japan und Europa richten. Verbessert die Erholung der Aktienmärkte die Stimmung der Unternehmen? Darüber hinaus wird noch der ifo-Index (Donnerstag) und das Konsumentenvertrauen der Eurozone (Dienstag) veröffentlicht. Hier könnte die Regierungsbildung in Deutschland für wieder mehr Optimismus gesorgt haben.
In China werden darüber hinaus noch die Industrieproduktion und die Einzelhandelsumsätze (beides am Montag) veröffentlicht. Die chinesische Konjunktur dürfte noch von den Vorzieheffekten vor den US-Zöllen profitiert haben und solide Wirtschaftsdaten zeigen. Die nächsten Monate werden spannend, ob die staatlichen Stimulusmaßnahmen ausreichend Gegengewicht zu einem Rückgang der Exporte bilden konnten.
Weitere Beiträge
Diese Unterlage der Metzler Asset Management GmbH (nachfolgend zusammen mit den verbundenen Unternehmen im Sinne von §§ 15 ff. AktG „Metzler“ genannt) enthält Informationen, die aus öffentlichen Quellen stammen, die wir für verlässlich halten. Metzler übernimmt jedoch keine Garantie für die Richtigkeit oder Vollständigkeit dieser Informationen. Metzler behält sich unangekündigte Änderungen der in dieser Unterlage zum Ausdruck gebrachten Meinungen, Vorhersagen, Schätzungen und Prognosen vor und unterliegt keiner Verpflichtung, diese Unterlage zu aktualisieren oder den Empfänger in anderer Weise zu informieren, falls sich eine dieser Aussagen verändert hat oder unrichtig, unvollständig oder irreführend wird.
Ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Metzler darf/dürfen diese Unterlage, davon gefertigte Kopien oder Teile davon nicht verändert, kopiert, vervielfältigt oder verteilt werden. Mit der Entgegennahme dieser Unterlage erklärt sich der Empfänger mit den vorangegangenen Bestimmungen einverstanden.
 Deutsch
Deutsch English
English